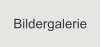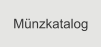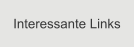HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN DER NUMISMATIK
"Ich habe noch viele 5 und 10 DM Gedenkmünzen - was sind diese Stücke Wert und verlieren sie ihren Wert mit der Einführung des Euros im Jahr 2002?" Einleitend kann man sagen, dass Sie sich keine Gedanken machen müssen, dass Ihre Münzen nach Einführung des Euros wertlos werden, Sie können Ihre Gedenkmünzen unbefristet in Euro umtauschen ! Nun zu den Werten: 10 DM Stücke haben in bankfrischer Erhaltung nur den Nominalwert von 10 DM. Die 5 DM Gedenkmünzen von 1966 bis 1986 sind ebenfalls nur mit Ihrem Nominalwert von 5 DM anzusetzen. Nur die von 1952 bis 1964 ausgegebenen 5 DM Sondermünzen haben einen teilweise wesentlich höheren Wert! "Wo finde ich Bewertungslisten für meine Münzen?" Suchen Sie doch einmal nach Ihren Münzen im Internet. Oder schauen Sie bei den Münzen-Verlagen unter der Rubrik LINKS vorbei. Gute Dienste leistet auch eine aktuelle Münzenzeitschrift, die Sie an jedem Bahnhofskiosk erhalten. Aber: Die genaue Wertbestimmung sollten Sie aber durch einen Fachmann vornehmen lassen, der über entsprechende Erfahrung und Marktkenntnis verfügt. "Ich habe ein 2 DM-Stück von 1951 gefunden, das aussieht wie ein 1 DM-Stück!" Diese Münze wurde 1958 außer Kurs gesetzt, weil man sie zu leicht mit der 1 DM Münze verwechseln konnte! Wert der Stücke in zirkulierter Erhaltung (sehr schön): D, F, J : ca. 25 € G ca. 80 €. "Was sind meine Münzen aus der ehemaligen DDR heute wert?" Diese Frage kann man nur nach Überprüfung einer Bestandsliste beantworten. Wertlose Münzen dagegen sind z.B. 20 M Pieck, Grotewohl, Schiller, 5 M Meißen, Brandenburger Tor 1971, 20 J. DDR etc. "Woran kann ich erkennen, ob das von mir erworbene 5 DM-Stück 1958 J echt ist?" Die Echtheit kann nur ein erfahrener Spezialist durch eine Untersuchung feststellen. Bei diesen Münzen besteht eine sehr große Gefahr der Fälschung bzw. Verfälschung, da diese Münze je nach Erhaltung einen Wert zwischen 500 und 6.000 € haben kann. Zur Sicherheit sollten Sie diese Stücke nur mit einem Foto-Gutachten von einem Fachmann kaufen! "Was bedeuten die Kürzel für die Erhaltungsangaben bei Münzen?" Gering erhalten = fair (engl.) Eine durch den jahrelangen Umlauf stark abgenutzte Münze mit vielen Kratzern und kleinen Beschädigungen. Diese Qualität gehört nicht in eine Sammlung moderner Münzen. S Schön = fine (engl.) Eine durch längeren Umlauf beträchtlich abgenutzte Kursmünze mit erkennbaren Reliefkonturen. Unterste Grenze einer sammelwürdigen Münze des 20. Jahrhunderts. SS Sehr schön = very fine (engl.) Nicht übermäßige Spuren des Umlaufs und normale Abnützungserscheinungen an den höchsten Stellen des Reliefs und der Legenden. VZ Vorzüglich = extremely fine (engl.) Geringe Abnützungsspuren an den höchsten Stellen des Reliefs. Jede Einzelheit ist deutlich sichtbar. ST Stempelglanz = uncirculated (engl.) Ohne jegliche Umlaufspuren: Bei Automatenprägungen von Umlaufmünzen können durch den Ausstoß der Münzen nach der Prägung in bereitstehende Behälter und durch gemeinsamen Transport in Säcken geringfügige Kratzer und Schleifstellen entstehen. PP Polierte Platte = proof (engl.) Hierbei handelt es sich um besonders hergestellte Stücke, die die Münzstätten gegen Aufpreis für Sammler fertigen. Bei dem Herstellungsverfahren werden ausgesuchte makellose Ronden sowie die Prägestempel poliert. Die dann als Einzelprägung hergestellte Münze wird mit der Hand abgenommen und einzeln verpackt. Sie zeichnet sich durch einen spiegelnden Untergrund und ein feinmattiertes Relief aus. Sie darf keinerlei mit bloßem Auge sichtbare Beschädigung aufweisen. "Wo kann man Münzen auf Echtheit überprüfen lassen und was kostet dies? Lohnt es sich für die sogenannte Massenware?" Münzen kann man z.B. bei einem erfahrenen Münzhändler überprüfen lassen. Besser ist allerdings die Überprüfung durch einen Sachverständigen der auch ein entsprechendes Gutachten erstellen kann! Die Kosten einer Prüfung sind abhängig vom Zeitaufwand der Überprüfung bzw. können auch prozentual (3 - 5 %) vom Schätzwert berechnet werden. Für sog. Massenware lohnt sich eine Überprüfung nicht. Ab einem Wert von 250 € oder bei besonders fälschungsgefährdeten Münzen ist ein Echtheitsprüfung und Gutachtenerstellung zu empfehlen. Begeistert suche ich auf Münzbörsen nach Fehlprägungen, Stempelfehlern und Schrötlingsdefekten. Wie entstehen eigentlich solche Stücke? Oft kommen trotz aller Kontrollen Münzen mit Prägefehlern in den Umlauf. Prägefehler entstehen beim Prägevorgang. Oft liegt die Münzronde nicht konzentrisch auf dem Unterstempel, sodass es nur zum Teil mit der Prägung bedeckt wird. Die Münze ist dann dezentriert. Manchmal ist der Schrötling nach der Prägung nicht schnell genug weitergeschoben worden und erhielt dann einen zweiten Oberstempelstoß, der jedoch die erste Prägung nicht ganz zerstört hat. Das wird als Doppelschlag bezeichnet. Es gibt auch Fremdkörperprägungen, bei denen ein Metallstück oder etwas anderes zwischen Schrötling und Prägestempel gekommen ist. Von Zweifachprägungen spricht man, wenn eine fertige Münze an einem Prägestempel hängen geblieben ist und die Münze bei der nächsten Prägung als eine Art Prägestempel wirkt. Der neu angekommene Schrötling bekommt dann eine Negativprägung. Bei der Stempelverdrehung weicht eine Stellung der beiden Münzseiten zueinander von der meist vorgeschriebenen Normalstellung ab. Die Randprägung dagegen kann immer in beliebiger Stellung zu den Münzseiten stehen, weil die Ronden vor der eigentlichen Prägung schon Randgeprägt werden. Bei den Stempelfehlern geht es um Fehler im Prägestempel. Der Stempel kann z.B. durch Rost korrodiert sein. Bei antiken Münzen findet man immer wieder Stempelrisse. Auch Stempelbrüche und Stempelsprünge führen zu entsprechenden Stempelfehlern, die die Münzen aufweisen. Bei Zwitterprägungen haben sich Münzbeamte bei den Prägewerkzeugen vergriffen. Besonders gern werden die Rändeleisen für die Randprägung vertauscht., z.B. bei dem 5 DM-Stück Mercator und bei der Produktion von DDR- Münzen mit dem Motiv Humboldt und Kollwitz. Oft hat der Graveur beim Schneiden der Stempel einen Fehler gemacht, z.B. bei Medaillen. Dann gibt es eine zweite Ausgabe mit der richtigen Jahreszahl. Oft sind bei der mechanischen, serienmäßigen Anfertigung der Prägestempel bestimmte Buchstaben nicht "gekommen", wie z.B. bei dem 2 DM-Stück Adenauer. Scharf von den Stempelfehlern zu unterscheiden sind die Stempelvarianten, die vor allem in alten Zeiten wegen der schnellen Abnutzung der Prägewerkzeuge entstanden. Ungezählte Fehlprägungen gehen auf mangelhafte Schrötlinge, Rondellen zurück. Oft werden vom Material her falsche, aber zufällig in der Größe passende Rondellen, Plättchen, eingesetzt, die die Münzstätte eigentlich für in Auftrag gegebene, ausländische Münzen bestimmt hatte. Diese Materialfehler lassen sich durch abweichende Farbe, differierendes Gewicht und vorhandene bzw. fehlende magnetische Fähigkeit erkennen. Früher gab es immer wieder absichtlich e Verwechselungen der Schrötlinge. So z.B. haben französische und spanische Münzmeister des 18. und 19. Jahrhunderts manchmal Platin-Schrötlinge an der Stelle von Gold. Rondellen benutzt und ihre Produkte dann vergoldet. Ein typischer Rondellenfehler ist die Fehllegierung oder das Fehlen einer Schicht bei Mehrschichtenwerkstoff, z.B. bei Münzen der BRD. Oft haben Schrötlinge eine Vertiefung, die durch Gaseinschluss oder spezielle Oxydierung entstanden sind. "Wie kommt es, dass es von der ehemaligen DDR so viele Probeprägungen gibt, während von allen anderen Sammelgebieten nur wenige vorhanden sind?" Die ehemalige DDR ließ solche Stücke in ziemlichen Mengen herstellen, und zur Devisenbeschaffung verkaufen. Von den Proben anderer Länder sind viele keine wirklichen Proben der staatlichen Münzstätten, sondern private Realisierung von nicht angenommenen Entwürfen. "Wie kommt es, dass das 50-Pfennig-Stück "Bank Deutscher Länder" 1950 G im Unterschied zum Jahrgang 1949 so selten ist?" Von dieser Münze wurden versehentlich 30.000 Stück in Karlsruhe geprägt. Die Inschrift hätte eigentlich schon "Bundesrepublik Deutschland" heißen müssen. Im Umlauf sind die Stücke inzwischen wohl nicht mehr aufzufinden, da schon viele Sammler die vorhandenen Stücke "herausgefischt" haben. Bevor unsere Deutsche Mark von dem wesentlich instabileren EURO abgelöst wird, möchte ich mich intensiv mit der Geschichte der DM befassen. Wo besteht die Möglichkeit sich genau zu informieren?" Im Geldmuseum der Deutschen Bundesbank, Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt/Main, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr, außer Mittwoch 13.00 - 21.00 Uhr. Hier findet man auf 850 qm eine lückenlose Dokumentation der Geschichte der Mark. Das Museum besitzt eine große Sammlung von 80.000 Münzen und 250.000 Geldscheinen aus aller Welt: Die umfangreiche Bibliothek kann auch von Besuchern benutzt werden. Das Motto der Ausstellung ist ein Ausspruch vom Begründer des Wirtschaftswunders Ludwig Erhardt "Instabiles Geld zerstört die Gesellschaften und sozialen Grundlagen jeder freien staatlichen Ordnung". "Werden bei der Einführung des Euros gleich genug Münzen zur Verfügung stehen?" Die deutschen Geldinstitute haben schon über 42,5 Millionen "Haushaltsmischungen" von je 19 Euromünzen, vom 2- Euro-Stück bis zum Cent, bestellt. Diese Zusammenstellung im Wert von 20 Euro wird schon ab Mitte Dezember 2001 an die Bevölkerung ausgegeben. Die neuen Euro-Banknoten werden aber erst ab 2. Januar 2002 in Umlauf gebracht. Die alten DM-Münzen und Banknoten sollen innerhalb von drei Monaten, also bis Ende März 2002 eingezogen werden. Die Umwechselung von Münzen und Banknoten ist aber auch danach noch unbegrenzte Zeit möglich. Sorge macht der Bundesbank dagegen der erwartete gewaltige Rücklauf der DM-Münzen. Seit 1949 sind fast 50 Milliarden Geldstücke geprägt worden, von denen 40 % als verschwunden gelten. Wie viele Münzen davon auch immer zurückfließen: Es geht in jedem Fall um ein Metallgewicht in fünfstelliger Tonnendimension. "Was soll ich von dem neuen Urteil des Bundesgerichtshofes (AZ VII ZR 111/99) halten, dass der Verkaufspreis von neuen Gedenkmünzen um ein Vielfaches über dem Metallwert bzw. dem Wiederverkaufswert liegen darf?" In diesem Fall hatte ein scheinbar cleverer Mann für DM 24.000,-- gängige ausländische Silbermünzen, vor allem Olympia-Prägungen, gekauft. Als der "Investor" die ganze Pracht wieder verkaufen wollte, musste er feststellen, dass es für diese Stücke kaum einen Verkäufermarkt gibt - außer der Verwertung zum Metallwert - welcher sich auf DM 2.250,-- belief. Der BGH erklärte zutreffend, solche Sondermünzen in Massenauflage würden in der Regel nicht als Geldanlage , sondern aus Freude am Sammeln erworben. Die eigenartige Preisentwicklung sei deshalb nicht sittenwidrig. Das Urteil ist m.E. in Ordnung, zumal der Händler nicht den falschen Eindruck erweckt hatte, der Käufer könne mit deutlichen Wertsteigerungen rechnen. Fazit: Hände weg von solchen Münzen, es sei denn, man sammelt sie wegen der schönen Motive. Auch hier sollte man unbedingt mehrere Angebote einholen und vor dem Erwerb unbedingt Preisvergleiche durchführen. "Wie kann man Maria-Theresien-Taler (Original) von den Nachprägungen unterscheiden ? Gibt es Jahrgänge, die auf Nachprägungen hinweisen, wie bei den Goldmünzen?" Der klassische Maria-Theresien-Taler von 1780 wird bis heute in Wien mit unveränderter Jahreszahl als Handelsmünze nachgeprägt - insgesamt ca. 400 Millionen Stück wurden bisher hergestellt. Der Maria-Theresien-Taler fand im 18. Jahrhundert eine sehr große Verbreitung in Arabien und Afrika. So sind z.B. ab 1800, verstärkt ab den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts (Eröffnung des Suezkanals) große Mengen (über 60 Millionen) nach Äthiopien geströmt, und waren dort noch bis 1945 das Hauptzahlungsmittel. In den fünfziger Jahren wurden sogar im Ostblock Maria-Theresien-Taler geschlagen. Es gibt minimale Unterschied in der Masse der Nachprägungen, mit denen sich Spezialisten gern befassen. Die Prägungen seit 1860 lassen sich auch durch die modernere Technik von den älteren Nachprägungen unterscheiden. Die in Günzburg geprägten Originale von 1780 sind selten. Es gibt auch Konkurrenzprägungen, wie z.B. venezianische Großsilbermünzen, die sich aber nicht durchsetzen konnten. "Welche Arten von Fälschungen gibt es und welche gefährden die Sammler?" Der Begriff Fälschung wird vielfach in unvertretbarer Weise mit anderen Begriffen verquickt und unrichtig angewandt. Eine Definition und Interpretation erscheint deswegen zuvor angebracht. Fälschung Wer unberechtigt Geldzeichen (Münzen, Banknoten) nachmacht und in Verkehr bringt, macht sich der Falschmünzerei schuldig (§ 146 StGB ff.). Als "echt" gebrauchen kann man jedoch nur gesetzliche Zahlungsmittel, deswegen sind im juristischen Sinne nur nachgemachte oder unbefugt geprägte gültige Geldzeichen als Faschgeld (Fälschungen) anzusprechen. Beispiel: Nachbildungen von kursfähigen DM-Münzen und Banknoten. Diese Fälschungen sind aber zum Schaden des Zahlungsverkehrs in Umlauf gebracht worden und sind für den Sammler nur von untergeordneter Bedeutung. Nachahmung Wer außer Kurs gesetzte Münzen (oder Medaillen) nachmacht und sie nicht auch für einen Laien erkennbar eindeutig als solche kennzeichnet (als Nachahmung gestaltet), macht sich nach § 11a des Münzgesetzes einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Eine derartige Nachbildung ist als Nachahmung (gewöhnlich auch als Fälschung bezeichnet) anzusprechen. Dazu gehören beispielsweise auch alle nachgemachten ungekennzeichneten Reichsgoldmünzen oder auch - zum Schaden der Sammler - die nachgemachten Silber- und Nickelmünzen des Kaiserreiches oder der Weimarer Republik. Nachprägung Dieser begriff wird leider am häufigsten unrichtig gebraucht und fälschlich anstelle von Nachahmung oder Fälschung benutzt. Der Begriff "Nachprägung" ist weder in einem unserer Gesetze noch in einer Verordnung zu finden, hat aber nach dem Sinngehalt des Wortes für "zeitlich später geprägte Münzen" seine Berechtigung, besser wäre der Begriff "Neuprägung". Beispiel: Österreich prägt noch heute Handels-Goldmünzen nach, die entweder die Jahreszahl 1892 oder 1915 tragen. Diese Neuprägungen haben eine gesetzliche Grundlage und sind von den Originalprägungen dieser Jahre weder äußerlich noch an ihrem Status zu unterscheiden. Es ist ferner bekannt, dass auch die Schweiz, Frankreich und Großbritannien zeitweilig Goldmünzen nachgeprägt haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Nachprägungen dieser Staaten (spätere Prägungen mit früheren Jahrgängen) echte Münzen sind. Manipulierte Münze Der jüngste Begriff, der sich im letzten Jahrzehnt gebildet hat, ist die manipulierte (verfälschte) Münze. Juristisch betrachtet ist, in einer bewussten, vorsätzlichen Veräußerung einer in ihren Geprägedetails veränderten (manipulierten), ansonsten echten Münze zumindest ein Betrugsversuch, wenn nicht vollendeter Betrug zu sehen. Das wird jeweils von den Umständen des Einzelfalls abhängen. Handelt es sich bei dem manipulierten Stück um ein gesetzliches Zahlungsmittel, kann ggf. sogar von Falschmünzerei gesprochen werden. Es gibt mehrere, technisch ganz verschiedene Arten von Fälschungen. Gussfälschungen In allen Zeiten gab es Nachgüsse von echten Stücken. Gussfälschungen sind billig herzustellen ! Man erkennt die Gussfälschungen an den Gussspuren, an winzigen Bläschen, an der grießigen , irgendwie flauen, weichen Oberfläche und den verwischten Rändern. Viele Gussfälschungen werden allerdings nachzisiliert. Heute ist die Technik des Schleudergusses besondert verbreitet. Originalmünzen werden in Rohgummi in vulkanischen Verfahren unter Druck abgeformt, wobei der Gusskanal freigehalten wird. Aus der so entstandenen Form werden die Originale vorsichtig herausgenommen. Die Form wird für mehrere Wachsausgüsse mit anhängendem Gussstab verwendet. Die so gewonnenen Wachsstäbe mit den Münznachbildungen aus Wachs am Ende werden in einen sog. Gussbaum montiert und mit einer Spezialmasse ausgegossen, die sich dann erhärtet. Nun wird mit der Hitze das bisher formgebende Wachs herausgeschmolzen und der Gussbaum im Schleuderverfahren mit dem Metall ausgegossen. Der ganze Zylinder wird abgekühlt, wobei die umhüllende Spezialmasse abspringt. Übrig bliebt der reine Gussbaum, von dem nun die Münzen abgelöst werden. Prägefälschungen Prägefälschungen werden mit einem angefertigten Stempel hergestellt. Viele Fälscher haben Stempel im Senkverfahren von echten Münzen abgenommen. Sie benutzen das Original gewissermaßen als Patrize, von der dann der Stempel, die Matrize, abgesenkt wird. Andere Fälscher schneiden den Stempel neu. Fälschungen von solchen neu in Stahl eingegrabenen Stempeln sind oft an der abweichenden, irgendwie modernen Schriftform, am ganzen Stil der Zeichnung und an der zu gleichmäßigen Randbehandlung zu erkennen. Bei vielen Fälschungen stimmt das Gewicht nicht. Es gibt im Bereich der Prägefälschungen auch "erfundene Münzen" für die ein Stempel zusammenphantasiert ist. Ein übler Trick bei der Prägefälschung antiker Münzen ist, echte aber wertlose Münzruinen als Schrötlinge zu benutzen. Dann stimmen Gewicht, Metallzusammensetzung und Form. Galvanos Noch heute sind galvanoplastische Nachbildungen gefährlich. Zu erkennen sind diese aus zwei Teilen zusammengefügten Fälschungen oft an der leichten Furche rund um den ganzen Rand. Hier sind nämlich die durch galvanische Niederschläge erzeugten Münzseiten zusammengelötet worden. Auch der Klang ist bei Galvanos fast nie in Ordnung: Die Stücke klingen dumpf - blechern. Verfälschungen Oft wird eine echte, aber gängige Münze zu einer seltenen umgearbeitet, besonders durch Aenderung der Jahreszahl oder des Münzzeichens. Beispielsweise beim seltenen 50-Pfennig-Stück "Bank Deutscher Länder" 1950 G oder dem 5 DM-Stück 1958 J. Oft werden erloschene Konturen durch Nacharbeiten mit dem Grabstichel aufgefrischt. "Wie lange geht bis zur Einführung des Euro die deutsche Kursmünzenprägung noch weiter?" Die Ausprägung von Kursmünzen wurde bereits 1996 beendet. Einzelne Stücke dieses Jahrgangs wurden in den Umlauf gebracht. Die Ausprägungen mit den Jahreszahlen 1997 bis 2001 werden nur noch für die Sammlersätze verwendet. Doch die Gedenkmünzenprägung soll bis zuletzt weiterlaufen. "Wie viele Münzen laufen offiziell in der Bundesrepublik um?” Ueber 47 Milliarden Geldstücke im Wert vom über 15 Milliarden DM sind in Umlauf gebracht worden. Nach Schätzung der Bundesbank sind aber nur noch ca. 60 % davon präsent. "Es besteht ein immer größeres Interesse bei den Sammlern an deutschen Blanketten (Schrötlinge), Wo kann man diese Stücke bekommen?" Besonders auf Münzbörsen werden immer wieder Schrötlinge (Rohlinge, Ronden) für deutsche Kursmünzen angeboten. Das ist nichts Besonderes, denn die Rohlinge werden von verschiedenen Privatfirmen hergestellt. Es ist aber außerhalb der Legalität, wenn bei höheren Nominalen gestauchte Schrötlinge mit Randschrift auftauchen. "Besonders häufig treten Fälschungen von antiken Münzen auf. Gibt es außer den bekannten Methoden neue Möglichkeiten zur Unterscheidung von echt und falsch?" Eine neue Methode zur Untersuchung von echten und falschen Münzen der Antike setzt sich durch: Die Münzen werden radioaktiv behandelt. Dann stellt man das Strahlenspektrum fest. In antikem Münzmetall findet man viele Verunreinigungen. Wenn das Münzmetall aber völlig rein ist, ist das Metall modernen Ursprungs und die Münze unecht. Aber: ganz schlaue Fälscher benutzen total abgenutzte und so wertlose, aber echte Stücke als Schrötlinge. "Bei einem Tauschabend wurde ein goldenes 20 Mark-Stück, Hamburg 1912 angeboten. Es entbrannte eine heftige Diskussion darüber, ob dieses Stück (J. 212) echt oder einfach eine Fälschung ist. In diesem Zusammenhang trat auch die Frage auf: Was versteht man unter einem Privatauftrag und wer war dazu berechtigt?" Selbst wenn das Stück echt ist, handelt es sich in diesem Fall um eine unbefugte Prägung, eine "Ferrarität". Der ledige und kinderlose Graf Phillipe la Renotiere de Ferrari (gest. 1917), auch jedem Briefmarkensammler bekann, ließ sich manchmal in Münzstätten mit echten Stempeln Stücke prägen, die es eigentlich nicht geben durfte. So etwas geschah auch mit dem Jahrgang 1912 mit dem Hamburger Wappen. Jede konnte als Privatmann bei Einlieferung von Gold im Jahre 1912 in jeder Menge 20 Mark-Stücke in Hamburg prägen lassen, aber er bekam dann vorschriftsgemäß nur Stücke mit dem Bildnis Kaiser Wilhelm II., wie das ein "allerhöchster Erlaß" von 1904 erlaubte bzw. dringend nahe legte. In diesem Fall liegt also kein Privatauftrag vor. Wenn es sich wirklich um eine Ferrarität handelt, gehört dieses Stück nicht auf einen Tauschabend sondern auf eine bedeutende Auktion und bringt dort einen entsprechend Verkaufserlös. Sehr viel wahrscheinlicher aber ist, dass die vorgelegte Münze aus dem Riesenreich der Hausmann- Fälschungen stammt. Eine Ferndiagnose ist ohne eine entsprechende Prüfung nicht möglich. Die Entscheidung müssen Spezialisten treffen, die mit allen technischen Finessen das Problem klären können. "Wann ist es sinnvoll eine Expertise von einem Sachverständigen für Münzen einzuholen?" Vor allem bei seltenen deutschen Münzen des 20. Jahrhunderts ist es üblich geworden, bei Verkauf die Expertise eines Sachverständigen einzuholen. Das ist außerordentlich vernünftig, sind doch Verkäufer und Käufer damit "auf der sicheren Seite". Die Notwendigkeit sei hier an einem Beispiel aus jüngster Vergangenheit geschildert. Es gab einige Fälle bei Prägungen von Deutsch-Ostafrika, konkret bei den mit der Jahreszahl 1916 in Tabora geprägten 20-Heller-Stücken, wo selbst die Experten eine exakte Bestimmung nicht vornehmen konnten. Im "Jaeger" sind diese Münzen unter den Nummern 724 bis 727 verzeichnet. Die jeweilige a-Nummer ist die Kupferprägung. Die b-Nummer des betreffenden 20 Heller-Stücks steht für die Messing- bzw. Tombakprägung. Die Preisunterschiede bei Jaeger 724 bis 726 für die Kupfer- und Messingversion erreichen in manchen Fällen 1.500 €! Sich in solchen Fällen nur auf die Augenscheinprüfung zur Unterscheidung von Kupfer, Messing oder Tombak zu verlassen, kann "ins Auge gehen". Sammler und Händler sind bei diesen Münzen gut beraten, wenn sie in der Expertise eine Aussage zur Dichte (Kupfer bei 20°C: 8,96 g/cm3 +/- 0,3 %) oder zur elektrischen Leitfähigkeit (Kupfer bei 20°C: 5,96 x 10-7 S/m) verlangen. Unterschreitet der Wert für die elektrische Leitfähigkeit 4 x 10-7 S/m, sollte er durch den gemessenen Dichtewert widerlegt werden, wenn es Kupfer sein soll. "Mir liegt eine 5-DM-Münze der BRD von 1992 vor, die kein Münzzeichen einer Prägeanstalt hat. An der Fehlstelle gibt es keine Anzeichen, dass ein solches Zeichen auch nur in einer Andeutung vorhanden war. Wurde hier das Münzzeichen vergessen oder handelt es sich um eine Fälschung?” Die Münze ist weder eine Fälschung noch wurde das Münzzeichen vergessen: Die Ursache für das Fehlen des Münzbuchstabens ist ganz einfach zu erklären: Ein Mikrotröpfchen Öl oder etwas Schmutz hat die betreffende Stelle des Stempels zugesetzt. "Nach meiner Erinnerung hat in den sechziger Jahren ein Zahnarzt Goldmünzen des Kaiserreiches hergestellt. Diese Exemplare waren kaum oder gar nicht von den Originalen zu unterscheiden. Können Sie mir mitteilen, welche Nominale und Jahrgänge mit welchen Münzzeichen hergestellt wurden?" Der Zahnarzt Dr. Schmidt aus Bonn hat praktisch alles nur mögliche nachgemacht. Die Herstellungsstätte der überragenden Nachahmungen nannte sich "Reichs-Goldmünze" und die Prägungen sind bis heute gefährlich. Etwa 98 % aller angebotenen, goldenen 5-Mark-Stücke erweisen sich bei der Prüfung als falsch. Trotz der fast perfekten Qualität der nachgemachten Münzen könne aber Kenner von der Münztechnik her doch noch die Fälschungen erkennen. Deshalb noch ein Hinweis: Goldmünzen des Deutschen Kaiserreiches sollte man nur aus absolut zuverlässiger Quelle kaufen bzw. sich vor dem Kauf die Echtheit der teuren Stücke durch eine Expertise eines Sachverständigen bestätigen lassen. "Vor kurzer Zeit wurden mir die Münzen J. 325 100 Jahre Bremerhaven und J. 350 100. Todestag Goethes angeboten - für nur DM 60,-- bzw. DM 30,--. Die Stücke zeigen Umlaufspuren und eine schöne Patina. Auffällig ist einzig das Fehlen der Randschriften. Die beiden Münzen zeigen dafür einen Riffelrand. Die Klangprobe lässt auf echtes Silber schließen. Das Gewicht stimmt. Wie sind diese Münzen zu beurteilen?" Bei diesen Stücken handelt es sich eindeutig um Fälschungen. Zwar sind bei echten Stücken manchmal die Randschriften nicht ganz in Ordnung, aber diese Münzen haben keinen Riffelrand. Da haben die Fälscher zwei Rändeleisen eingespart. Im übrigen: Schnäppchen an echten Stücken der Weimarer Zeit mit solchen Preisen gibt es nicht. Jedermann benutzt heute Kataloge oder überschätzt eher den Erhaltungszustand seiner Münzen. Gerade die von ihrer Gestaltung schönen Münzen der Weimarer Zeit sind extrem fälschungsgefährdet. "Wie reinigt man am bestem verschmutzte Münzen?" Grundsätzlich gilt bei der Münzreinigung besser zu wenig, als zuviel reinigen! Und doch lässt sich eine reinigende Konservierung nicht umgehen. Normalen Schmutz entfernt man auf Münzen aller Art am einfachsten mit einem lauwarmen Feinseifenbad. Auch mit Ajona-Zahnpasta kann man Münzen zart reinigen. Das Prinzip der heute häufig angewandten Ultraschallreinigung besteht darin, dass elektrische Energie in hochfrequente, mechanische Schwingungen umgesetzt werden und diese auf eine Reinigungsflüssigkeit, z.B. eine Seifenlösung, übertragen werden. Die Münzen müssen nach jeder Behandlung rundum getrocknet werden. Es darf niemals ein Wassertropfen auf einer Münze antrocknen! Stets sollte man nur eine Sorte Münzen gleichzeitig behandeln! Goldmünzen (Au) bestehen aus einem sehr wiederstandfähigem Metall, das eigentlich gar keiner Pflege bedarf; noch nicht einmal zaponieren ist hier erforderlich, weil sich Gold eigentlich auch in Jahrhunderten kaum verändert. Genauso wie Platin (Pt) oxydiert es nicht und wird weder von der Luft, also vom Sauerstoff, noch von Säuren und nicht einmal von konzentrierter Schwefelsäure angegriffen. Angelaufene Silbermünzen (Ag) werden heute meistens mit speziellen Silber-Tauchbädern gereinigt bzw. konserviert. Auch wässerige Lösungen von Natriumnitrat, also von zitronensaurem Natrium bringen Erfolg. Auch Reinigungsbäder mit 50 % Salmiakgeist bewähren sich. Stets muss man hinterher die Münzen gut wässern! Münzen aus Gelbmetallen, wie Messing(Cu-Zn), Bronze(Cu-Sn) oder Tombak (Cu-Zn) haben eigentlich gleichartige oder zumindest sehr ähnliche Legierungen, denn sie bestehen alle überwiegend aus Kupfer(Cu) und Zink(Zn). Diese Legierungsbestandteile müssen allerdings sehr aufmerksam beachtet werden. Es genügt nicht zu wissen, dass man verschiedene Metalle nicht in ein gemeinsames Gefäß legen darf, sondern man sollte möglichst auch gleichfarbige Münzen mit unterschiedlichen Legierungsbestandteilen getrennt behandeln. Ist der Reinigungserfolg nach gründlicher Vorwäsche und Tauchbad nicht zufriedenstellend, dann folgt eine zweite Stufe. Eine Art Wundermittel ist "Greenwater", allerdings nicht ganz so harmlos, da es auf Basis von Eisenentrostungsmitteln hergestellt wird. In "Greenwater" darf die Münze höchstens 30 Sekunden liegen, danach gut spülen und evtl. mit Natronpulver abreiben. Zu einer weiteren Verbesserung des Reinigungserfolges kann ein erneutes Tauchbad führen. Im Boden gefundene, von hässlichem Grünspan angefressene Bronzemünzen (Cu-Sn) lassen sich galvanisch reinigen: Man legt die Münzen also zwischen Zinkbleche oder umwickelt sie mit Staniolpapier und bringt sie dann in Natronlauge. Der dabei entstehende, geringe Strom zersetzt die Verunreinigungen und macht sie lösbar. Der beste Schutz einer antiken Münze, die stets Jahrhunderte in der Erde verbracht hat, ist die gewachsene Patina, auch wenn diese - und das ist ein schweres Problem besonders bei den kleinen Münzen der Spätantike - erhebliche Teile des Münzbildes verbirgt. Werden Münzen der Antike angreifend "gereinigt", sind sofort 70% des Wertes dahin. Auf diese Weise sind ungezählte Münzen ruiniert worden. Besonders aggressiv ist die Absäuerung der Patina mit stark verdünnter Salzsäure - auch wenn so die Prägung zunächst bestens herauskommt. Man erkennt die so misshandelten Münzen sofort an dem verdächtig frischen, rötlichen Kupferglanz. Oft werden sie anschließend von chemischen Rückständen völlig zerstört. Man kann Fundmünzen immerhin mit Feinseife kochen und dann gut nachspülen und sorgsam trocknen. Dann bringt ein Hauch Pflanzenöl die Konturen auf unschädliche Weise heraus. Gewagt ist schon, mit Zaponlack-Spray, der schnell trocknet, die Konturen dauerhaft hervorschimmern zu lassen. Aber verändert sich die Farbe der Patina meistens vom Grünen ins Schwarze. Im Zweifelsfall sollten antike Münzen nicht behandelt oder gereinigt, sondern so wie sie sind in die Sammlung gelegt werden. Zinkmünzen (Zn), z.B. deutsche Städte-Notmünzen, müssen unbedingt konserviert werden, da sie sonst durch Korrosion bzw. Zinkpest zerstört werden. Zaponlack ist hier das beste Mittel, dem aber ca. 30 % Verdünner zugesetzt werden muss. Am einfachsten ist die Verwendung von Zaponlackspray. Eisenmünzen (Fe), also vor allem Notmünzen und Kriegsgeld, sowie alte Prägestempel müssen erst mit handelsüblichen Mitteln entrostet werden, auch wenn die Rostnarben deutlich werden. Dann lassen sie sich mit einem Hauch Paraffinöl konservieren, doch dürfen die Münzen nicht überfettet werden. Mann kann sie aber auch zaponieren. Die Eisenmünzen des Deutschen reiches ab 1915 wurden in der Münzstätte mit Zinkstaub überzogen, der sie schützen soll. Diese Beschichtung sollte erhalten bleiben! Kupfermünzen (Cu) müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Meistens genügt eine zarte Reinigung mit einer dünnen Seifenlauge, evtl. Aufkochen, u.U. mit etwas Natronpulver. Wichtig ist hinterher ausgiebiges Wässern. Anschließend können die Münzen vorsichtig mit Paraffin betupft werden. Kupfer-Nickel-Münzen (Cu-Ni) dürfen nie zusammen mit Kupfermünzen behandelt werden, da sie sich sofort bräunlich verfärben. Auch die stets gefährlich zur Oxydation neigenden Aluminiummünzen (Al) müssen unbedingt konserviert werden. Meist hilft ein Schutzfilm aus säurefreier Vaseline. Im Ganzen gilt: Notwendige Konservierung ja - Verschönerung - nein! Manche Art der Verschönerung, wie z.B. die zarte Neuversilberung von Billonmünzen (Ag-Cu) ist bereits eine Verfälschung!!! Die durchsichtigen Aufbewahrungs-Folien bzw. Alben sind heute nur noch in Ausnahmefällen schädlich. Oft werden Münzen in Folien tatsächlich vor der Oxydation geschützt. Immer wieder laufen allerdings Münzen in Folien und amtlichen Verpackungen an. Immerhin halten sich prägefrische Münzen meistens in von den Münzstätten mitgelieferten Münzdosen am Besten. Eine vorsichtige Reinigung und Konservierung von Münzen sollte man durch ständiges Experimentieren mit wertlosen Stücken ausprobieren. Die Münzreinigung ist auf jeden Fall ein schwieriges Gebiet. Im Zweifelsfall sollte man die Reinigung und Konservierung von wertvollen Münzen lieber von einem Fachmann vornehmen lassen!






Notizen

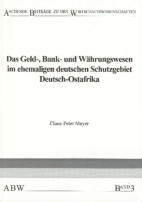

Seitenanfang
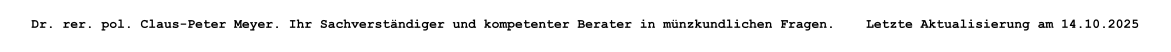

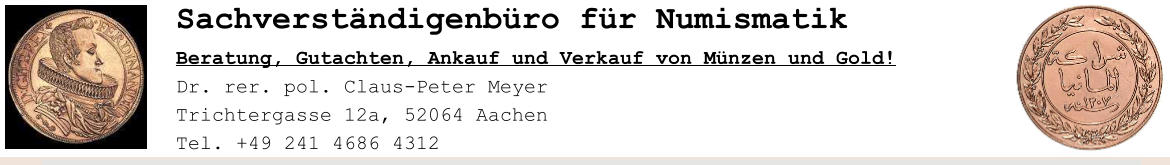
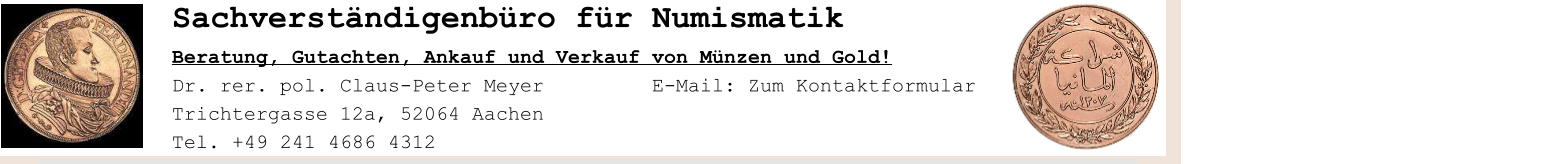




- Münzen als Wertanlage
- Das Geld-, Bank- und Währungswesen im ehemaligen deutschen Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika
- Der China-Autodollar von 1928
- Silber haben wir keines, aber Gold haben wir genug
- Die Banknoten der Deutsch-Ostafrikanischen Bank
- Die Archäologischen Ausgrabungen und die Münzfunde von Kalkriese im Osnabrücker Land
- Die Entdeckung von Goldmünzen in Kalkriese
- Neuer Silbermünzfund in Kalkriese
- Die Banknoten der Deutsch-Ostafrikanischen Bank (Ausgabe money trend 09/2025)
- Silber haben wir keines, aber Gold haben wir genug (Ausgabe money trend 10/2025)